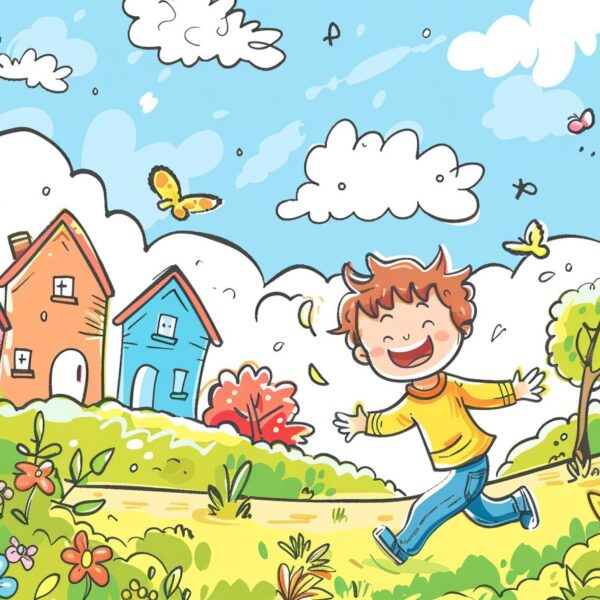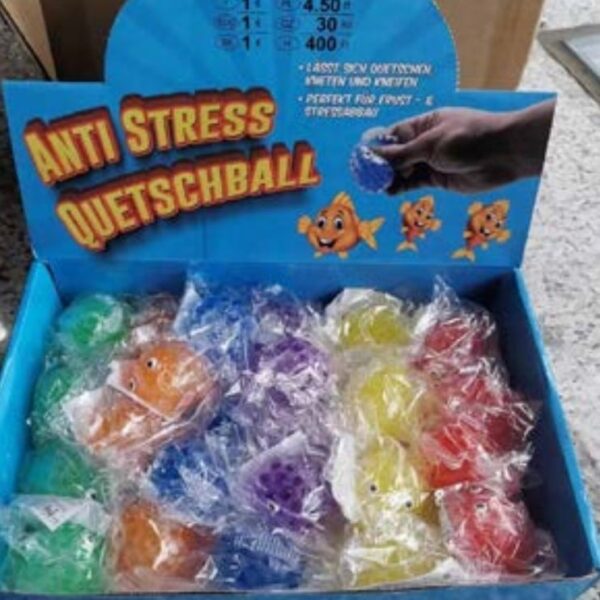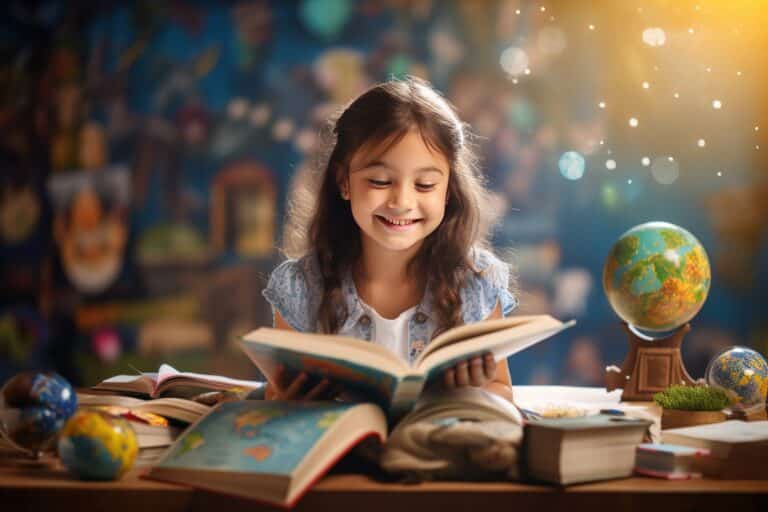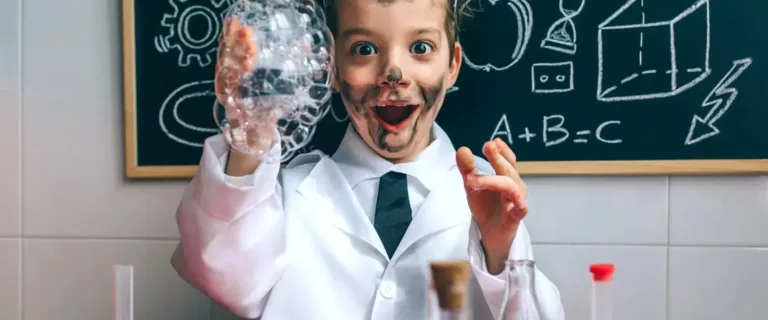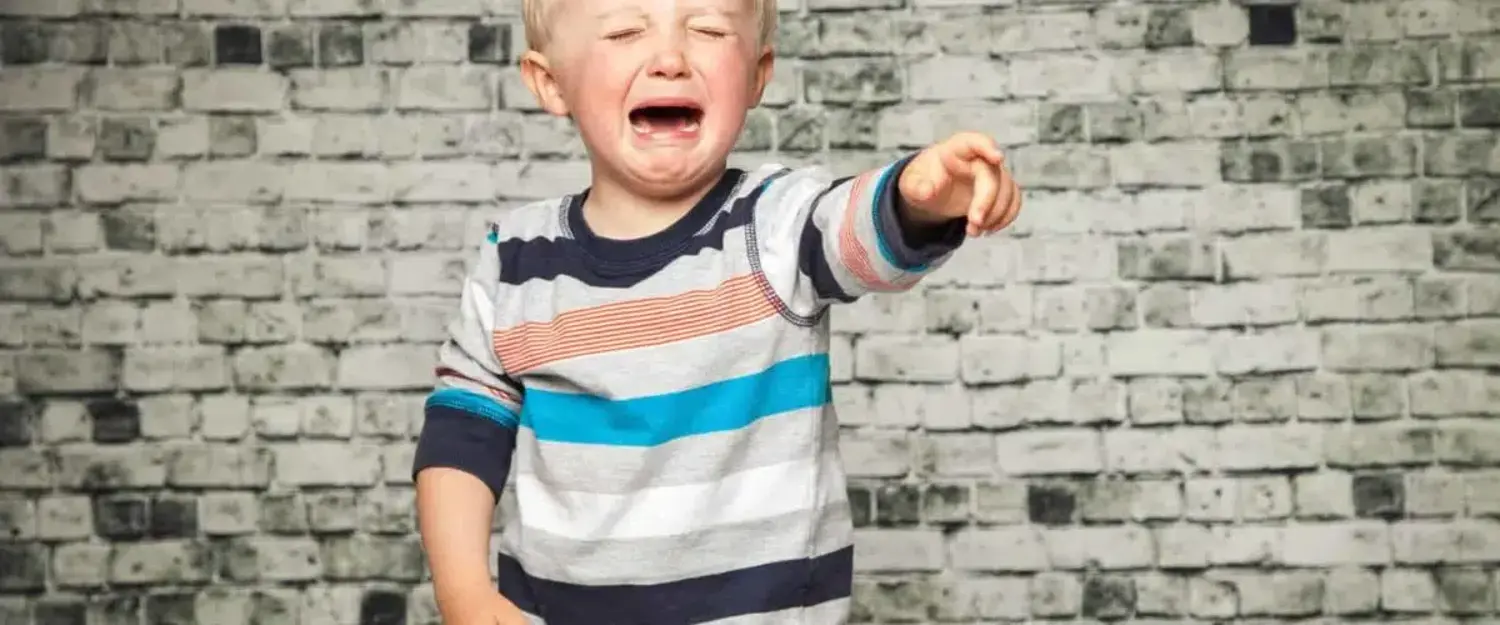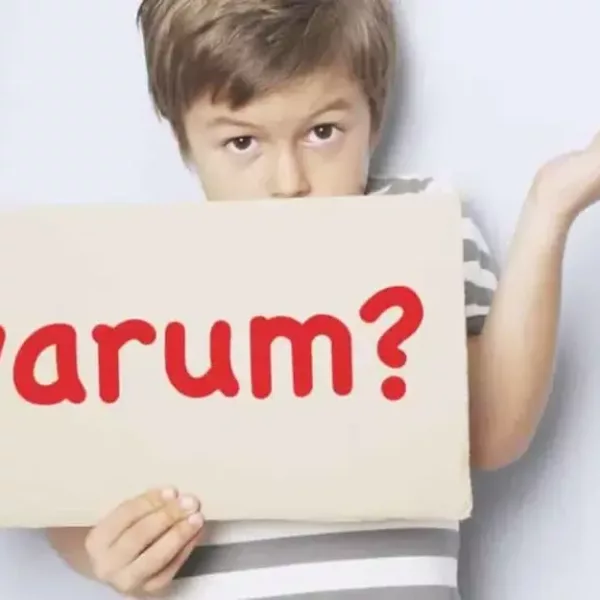Das Magazin für Eltern und Familie
Wir sind das Magazin für Eltern und Familie. In unserem Eltern Ratgeber ‘1-2-family.de’ findet ihr tolle Informationen, Tipps und Hilfestellungen, rund um die Themen Schwangerschaft, Babys, Kinder und das Elternsein. Findet bei uns Abhilfe, wenn das Familienleben mal wieder etwas stressiger wird. Sucht nach leckeren Rezepten, die auch die Kleinsten begeistern, und seid schnell informiert, wenn es eine wichtige Verbraucherwarnung im Zusammenhang zu Kindern und Familie gibt. Wir sind für euch da.
Unsere meistgelesenen Beiträge und Eltern-Ratgeber
Kalender der besonderen Tage: Welttage, Aktionstage, Gedenktage und Thementage im Überblick
Die Hochzeitstage und Jubiläen: Liste der Namen und Bedeutungen
Geburtstagssprüche – die schönsten Glückwünsche zum Geburtstag
Die schönsten Sprüche zur Geburt
Schülerwitze: die besten Witze über Schüler und Schule
Unser Familienleben – Alltag in der Familie
Das Familienleben ist der geschützte Rahmen, in denen unsere Kinder ihre Kindheit verbringen. Familie zu leben, ist eine ganz wundervolle Aufgabe, in der es oft genug auch einmal hektisch und stressig werden kann. Hier findet ihr tolle Informationen und Ratgeber für Eltern und Familie.
Wirklich gute Geschenke zur Geburt für Baby und Eltern
Mutterschutz – Diese Rechte habt ihr während der Schwangerschaft und danach
Über den Tod sprechen – Kinder brauchen Ehrlichkeit
Typisch Papa: Tipps für die lockere, aber bestimmte Erziehung
Besonderheiten und Tipps für Eltern mit Winterbaby
Drei Fragen zu Familie und Familienalltag
Wie beantrage ich Elterngeld?
Das Elterngeld wird bei der zuständigen Elterngeldstelle beantragt. Da sich die benötigten Formulare von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können, ist es wichtig, hier die korrekte Elterngeldstelle herauszusuchen. Abgefragt werden darüber hinaus Einkommensnachweise oder auch Steuerbescheide, Bescheinigungen zu Elternzeit, Mutterschaftsgeld, Personalausweis-Kopien – und natürlich die Geburtsurkunde eures Babys. Was ihr genau wann wohin schicken müsst, erfahrt ihr in unserem Beitrag zum Antrag des Elterngeldes.
Welche Rechte haben Stiefvater und Stiefmutter?
Stiefelternteile können im Rahmen des sogenannten “kleinen Sorgerechts”, typische Alltagsangelegenheiten für ihre Stiefkinder mit-entscheiden bzw. entscheiden. Der zugehörige rechtliche Paragraph, § 1687b BGB, umfasst unter anderem ausdrücklich Rechte und Pflichten, in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, Kleidung und körperliche Hygiene. Mehr zu den Rechten und Pflichten von Stiefeltern, erfahrt ihr in unserem zugehörigen Beitrag.
Verwöhne ich mein Kind zu sehr?
Diese Frage stellen sich tatsächlich wesentlich mehr Eltern, als man denken sollte. Denn selbst schon im Babyalter kommen in der Familie oder im Freundeskreis mitunter Diskussionen zu diesem Thema auf. Dabei steht völlig fest, dass man ein Baby nicht verwöhnen kann. So sehr man es sicher gerne möchte. Aber bei Kindern gibt es etwas, dass wir den “Liebesspeicher” nennen. Dabei sollte man wissen, dass ein Kind nicht zu einem sprichwörtlich “verwöhnten Kind” wird, wenn man es verwöhnt. Dieses negative Bild hat völlig andere Ursachen.
Das Familienbett: Segen oder Fluch für Elternpaare?
Warum es so wichtig ist, dass Kinder Fehlschläge durchleben müssen
Spielen mit Kindern: Das sind die Spielregeln für Eltern
Alltag mit Baby und Kleinkind: Rituale und Strukturen helfen!
Wenn kleine Kinder beißen: Warum Eltern sich nicht schämen müssen
Ratgeber zur Schwangerschaft
Hier begleiten wir euch von den ersten Anzeichen einer Schwangerschaft, bis zur Geburt eures Babys, durch eine wirklich spannende Zeit. Was tut euch und eurem Baby während der Schwangerschaft gut? Was sollte man als schwangere Frau möglichst vermeiden? An welche Dinge sollte man vor der Geburt denken? Auf all diese Fragen findet ihr hier Antworten.
Drei Fragen zur Schwangerschaft
Woran erkenne ich den Unterschied von Übungswehen und Geburtswehen?
Wenn man im Freundeskreis nach dem Unterschied von sogenannten Übungswehen oder Eröffnungswehen und den Geburtswehen fragt, bekommt man oft die Antwort, dass man es sofort erkennt, wenn man es spürt. Ist es jedoch die erste Schwangerschaft, bleibt diese Antwort so lange abstrakt, bis man die Geburt vollzogen hat. Es gibt jedoch einige Anzeichen, an denen man echte Eröffnungswehen erkennen kann. Mehr dazu erfahrt ihr im zugehörigen Beitrag unseres Eltern-Ratgebers.
Welche Faktoren gibt es für eine Risikoschwangerschaft?
Leider gibt es auch einige Umstände und Faktoren, aus denen heraus eine Schwangerschaft medizinisch als Risikoschwangerschaft eingestuft wird. In solchen Fällen sollte man tief durchatmen, jedoch nicht in Panik geraten. Denn solch eine Einstufung zur riskanten Schwangerschaft heißt erst einmal, dass man in kürzeren Abständen und insgesamt intensiver, durch diese Zeit begleitet wird. Natürlich kann es auch hier zu Schwangerschaftsbeschwerden kommen. Aber nicht zwingend öfter, als im Durchschnitt. Übliche Faktoren für eine Einstufung zur Risikoschwangerschaft sind das Alter der Mutter, eventuelle frühere Fehlgeburten, Vorerkrankungen und die Einnahme von Medikamenten. Auch eine rasche erneute Schwangerschaft nach einem Kaiserschnitt wird als Risikofaktor gewertet.
An was muss ich vor und nach der Geburt denken?
Wenn man schwanger ist, kümmert man sich natürlich in erster Linie darum, fit durch die Schwangerschaft zu kommen. Dem Baby soll es auch schon in Mamas Bauch gut gehen. Allerdings gibt es neben dem eigentlichen Schwangersein auch die Vorbereitung auf das Baby. Denn irgendwann steht die Geburt an. Es soll ja schließlich alles fertig sein, wenn das Baby da ist. An was ihr alles denken müsst, haben wir in einem Beitrag für euch zusammengefasst.
Entwicklung von Säuglingen und Babys bis zum Kleinkind
Hier findet ihr tolle Eltern-Ratgeber und wertvolle Informationen zur körperlichen, motorischen und kognitiven Entwicklung, von Babys und Kleinkindern. Lest hier, wie ihr als Eltern die Entwicklung eurer Kinder ganz aktiv unterstützen könnt.
Ratgeber zur Erziehung: Das Leben mit Kindern
Als Eltern möchten wir unsere Kinder mit aller Liebe und Energie auf das Leben vorbereiten. Dabei durchlaufen sie vom Baby bis zum Teenager unzählige Entwicklungsschritte und Phasen, in denen sie sich ausprobieren und zu eigenständigen Personen heranwachsen. Die Rolle der Eltern ist es, sie dabei zu begleiten, aufzufangen und zu fördern. Unsere Ratgeber sollen euch dabei unterstützen.
Gesundheit für die ganze Familie
Auch Gesundheitsthemen und Fragen zur Gesundheit, begleiten uns jeden Tag im Umfeld von Familie. Für Eltern ist es wichtig, dass vom Baby bis zu den Großeltern, alle gesund und fit durch den Tag kommen. Unsere Informationsartikel und Elternratgeber sollen euch dabei unterstützen, euer Wissen zu Gesundheitsfragen zu erweitern.
Mit 1-2-family.de als Familie auf der sicheren Seite

Egal ob ihr Ersteltern seid, oder bereits eine erfahrene kleine Familie mit mehr als einem Kind. Im Familienalltag treten regelmäßig Fragen und Herausforderungen an den Tag, mit denen man sich SO noch NIE beschäftigen musste. In den meisten Fällen lässt man sich dabei auf ein spannendes Abenteuer ein. Aber manchmal kommen auch ernste und drängende Fragen auf. Wir arbeiten hier bei 1-2-family.de täglich mit viel Herzblut und Blick über den Tellerrand hinaus, um euch in hoffentlich vielen Situationen einen frischen Blick, oder dringend nötige Informationen, an die Hand zu geben. Denn wir lieben es, wenn Kinder und ihre Eltern abends mit einem Lächeln einschlafen können.